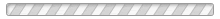
Identifikation (kurz)
Titel
Bremische Gesandtschaft Berlin
Laufzeit
1919 - 1937
Bestandsdaten
Geschichte des Bestandsbildners
1. Geschichte der Bremischen Gesandtschaft Berlin
a. Das-Ende der Hanseatischen Gesandtschaft in Berlin und die Schaffung einer eigenen ständigen Vertretung Bremens in Berlin
Seit 1859 war am Kgl. Preußischen Hof in Berlin als gemeinsamer Vertreter Hamburgs, Bremens und Lübecks ein hanseatischer Ministerresident akkreditiert, der 1888 die neue Beglaubigung als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister der drei Hansestädte erhielt. Nachdem die Städte auf Grund der Verfassungen des Norddeutschen Bundes von 1867 bzw. des Deutschen Reiches von 1871 im Bundesrat vertreten waren, bediente sich Lübeck des hanseatischen Ministerresidenten in Berlin als ständigen Bevollmächtigten, während Hamburg und Bremen jeweils ein Mitglied ihrer Senate zum Bundesrat bevollmächtigten und den Ministerresidenten zu dessen Stellvertreter bestimmten. Die Neuordnung des Deutschen Reiches im Jahre 1919 jedoch und die neue Reichsverfassung der Weimarer Republik stellten die diplomatischen Beziehungen zwischen den einzelstaatlichen Regierungen und dem Reich auf eine rechtlich völlig neue Grundlage, ja, stellten die Gesandtschaften der deutschen Länder überhaupt in Frage. Der Präsident des preußischen Staatsministeriums Hirsch hatte am 18. Juli 1919 den deutschen Länderregierungen, darunter auch dem Senat der Freien Hansestadt Bremen, mitgeteilt, die preußische Staatsregierung habe beschlossen, die preußischen Gesandtschaften bei den deutschen Einzelstaaten mit dem 1. Oktober d. J. fortfallen zu lassen. In der neuen Reichsverfassung sei der Gedanke des Einheitsstaates bzw. der Vereinheitlichung so weit verankert worden, dass daneben für einen diplomatischen Verkehr der Einzelstaaten untereinander genügend Raum nicht mehr bleibe. Der künftige Verkehr zwischen den Regierungen der deutschen Staaten und die Beibehaltung der notwendigen Fühlung untereinander könnten auch ohne ein diplomatisches Zwischenglied erfolgen. Damit war die Frage nach der weiteren Existenz der Hanseatischen Gesandtschaft in Berlin unmittelbar aufgeworfen worden. Der Bremer Senat erbat Bedenkzeit, da eine Entscheidung nur im Zusammengehen mit den Regierungen von Lübeck und Hamburg
gefällt werden konnte. Bereits vorher war dem Senat ein Hinweis auf die bedrohte Stellung der bundesstaatlichen Gesandten in Berlin zugekommen. Senator Dr. jur. Friedrich Nebelthau, der seit dem 25. Januar 1919 als Vertreter Bremens an den verfassunggebenden Verhandlungen in Weimar teilnahm und das Land im Staatenausschuss vertrat, hatte im engen Kontakt mit den Gesandten Bayerns, Sachsens, Württembergs, Badens und Braunschweigs erfahren, dass die Absicht in Berlin bestehe, die Pflege der zwischenstaatlichen Beziehungen nicht mehr dem Ministerium des Äußeren, sondern dem des Inneren zu übertragen. Reichskommissare sollten in den deutschen Staaten mit der Wahrnehmung der bisherigen diplomatischen Aufgaben betraut werden. Das diplomatische Korps, das hierin eine Beaufsichtigung und einen Angriff auf die Hoheit und Selbständigkeit der Länder erblickte, lehnte sich gegen diese Pläne unter der Führung Bayerns und Sachsens energisch auf. Schwierig war das rechtliche Verhältnis, unter dem die deutschen Staaten ihre bisherigen Vertretungen weiter beibehalten konnten. Da eine Vertretung beim Reich ausschied und die früheren Gesandtschaften beim Königlich Preußischen Hof akkreditiert gewesen waren, mussten neue Wege gesucht werden. Aus den alten Bundesstaaten des Kaiserreiches waren Länder eines Einheitsstaates geworden, denen man die zum aktiven oder passiven Gesandtschaftsrecht erforderliche völkerrechtliche Anerkennung als politische Körperschaft schwerlich mehr zustehen konnte. Preußen lehnte, wie bereits geschildert, weitere diplomatische Kontakte zu den deutschen Staaten ab, denen so vorerst nur die Möglichkeit blieb, eine einseitige Beglaubigung bei der preußischen Regierung zu suchen oder aber eine Möglichkeit im Ausbau ihrer Stellung als Reichsratsmitglied zu finden. Am 6. August 1919 fand im Rathaus zu Hamburg die erste Besprechung zwischen den Vertretern der Senate von Lübeck, Bremen und Hamburg über die Frage der zukünftigen Gestaltung der Vertretung der
Hansestädte in Berlin statt. Bremischerseits nahmen Bürgermeister Dr. Martin Donandt und Senator Dr. Friedrich Nebelthau teil, Senator Dr. Sthamer und Regierungsrat Dr. Merck vertraten Hamburg, während Lübeck vor allem durch Bürgermeister Fehling und Senator Dr. Neumann vertreten wurde. In den sich im Wesentlichen bis zum 22. Oktober 1919 hinziehenden Verhandlungen zeigte sich deutlich, dass Bremen einem weiteren Fortbestand der Hanseatischen Gesandtschaft völlig ablehnend gegenüberstand. Neben den bereits genannten verfassungsmäßigen Schwierigkeiten glaubte man, die Verhältnisse der Zeit seien über die gemeinsame Vertretung in Berlin hinausgewachsen. Zudem brauche man zur Lösung der anstehenden schweren wirtschaftlichen und politischen Aufgaben einen eigenen bremischen Vertreter umso mehr, als die Interessen Bremens mit denen Lübecks und Hamburgs in Manchem auseinandergingen und in der vergangenen Zeit nicht selten durch Alleingänge der hamburgischen Regierung geschädigt worden waren. In Bremen selbst war das Verlangen nach einer eigenen Vertretung in Berlin im Verlaufe des 1. Weltkriegs so stark geworden, dass es im September 1919 in der Nationalversammlung zu dem Plan kam, den Senat durch einen Initiativantrag zur Schaffung einer solchen Vertretung zu zwingen. Während Nebelthau so im Einverständnis mit Senat und Nationalversammlung die Lösung Bremens aus der Hanseatischen Gesandtschaft anstrebte, versuchte Lübeck auch weiterhin an der Hanseatischen Gesandtschaft und damit am Prinzip der Gemeinsamkeit hanseatischer Interessen festzuhalten. Hamburg dagegen spielte ein doppeltes Spiel. Während es in zweiseitigen Verhandlungen Bremens Stellungnahme billigte, beschwor es in den gemeinsamen Verhandlungen den alten hanseatischen Geist, obgleich es seit dem Jahre 1917 bereits durch den Senator Strandes eine eigene ständige Vertretung in Berlin eingerichtet hatte, die es allerdings als vorübergehende Kriegserscheinung abtat. Das Bemühen Hamburgs, die Verantwortung für
die Aufhebung der Hanseatischen Gesandtschaft Bremen zuzuschieben, wird hier allzu deutlich, umso mehr, als das Verhalten Senator Sthamers durchaus nicht von allen Hamburger Kreisen gebilligt wurde. Als auch der letzte Lübecker Versuch scheiterte, die Hanseatische Gesandtschaft als eine den Sondervertretungen der drei Staaten übergeordnete gemeinsame Ausdrucksform beibehalten zu können, kündigte Bürgermeister Dr. Martin Donandt im Namen des Senats am 20. Oktober 1919 die hanseatische Gemeinsamkeit auf und teilte den Regierungen von Hamburg und Lübeck die Absicht mit, zum 1. April 1920 eine eigene bremische Vertretung in Berlin einzurichten. Erleichtert wurde dieser Schritt dadurch, dass Preußen inzwischen die Auflösung seiner Ländergesandtschaften auf den 1. April 1920 verschoben hatte und auf den Druck süddeutscher Staaten hin begann, seine Stellung zu diesem Fragenkomplex zu überprüfen und in Besprechungen darüber mit den deutschen Staaten einzutreten. Am 7. November 1919 ersuchte die bremische Nationalversammlung den Senat um die Vorlage zur Schaffung einer selbständigen Vertretung in Berlin, die in den Mitteilungen des Senats vom 13. Dezember d. J. erfolgte, in denen der Senat von der Nationalversammlung "die Stelle eines bevollmächtigten Ministers der freien Hansestadt Bremen in Berlin, der zugleich Stellvertreter des bremischen Vertreters im Reichsrat ist" wünschte und ihren Antrag u.a. wie folgt begründete: "Im Reichsrat und seinen Ausschüssen begegnen sich unter dem Vorsitz von Mitgliedern der Reichsregierung die Vertreter der deutschen Länder zu gemeinsamer Arbeit. Ist auch die Zuständigkeit des Reichsrats auf die Gesetzgebung und die Verwaltung des Reichs beschränkt, so wird doch durch die regelmäßigen Zusammenkünfte diejenige Fühlung unter den einzelstaatlichen Regierungen auch in anderen als Reichsangelegenheiten erreicht, die namentlich auch von der preußischen Regierung als unerläßlich anerkannt wird. Es ist damit der Boden bereitet, auf dem die
einzelstaatlichen Vertreter, ohne selbst eine diplomatische Eigenschaft zu besitzen, Aufgaben lösen können, die in das diplomatische Fach fallen." Am 19. Dezember 1919 stimmte die bremische Nationalversammlung der Regierungsvorlage zu, der sich am 24. Dezember der Senat anschloss und am 30. Dezember den Senator Dr. jur. Friedrich Nebelthau zum bevollmächtigten Minister der Freien Hansestadt Bremen in Berlin und Stellvertreter des bremischen Vertreters im Reichsrat ernannte (Anlagen Nr. 3 und Nr. 4). Die Vertretung Bremens in Berlin ruhte damit vom 1. Januar 1920 an in den Händen Nebelthaus, daneben auch noch in denen des hanseatischen Gesandten Dr. Sieveking, der jedoch, wie nun im Januar 1920 in Hamburg und Lübeck beschlossen wurde, zum 31. März 1920 sein Amt niederlegen sollte.
Für die Ernennung eines bevollmächtigten Ministers hatte sich der Senat in der Annahme entschieden, dass für Gesandtschaften in der neuen Republik kein Raum mehr sei. Das sollte sich als Irrtum herausstellen. Auf den Druck der süddeutschen Staaten und Sachsens hin hatte Preußen im ersten Halbjahr 1920 seine Stellung zur Gesandtschaftsfrage einer Änderung unterzogen und seine Gesandtschaften für Süddeutschland in München und Norddeutschland in Dresden beibehalten. Als nun Anhalt seine Vertretung in eine Gesandtschaft umwandelte und Hamburg und Lübeck diesem Schritt folgten, sah sich der Bremer Senat zu der Überlegung gezwungen, ob diesem Schritt gefolgt werden könne. Nachdem Senator Heinrich Bömers nach einem Besuch in Berlin berichtete, die Bremische Vertretung werde im Gegensatz zu den Gesandtschaften anderer Länder besonders vom Ausland als diplomatische Instanz zweiter Klasse betrachtet, konnte sich der Senat den notwendigen Konsequenzen nicht weiter entziehen und beantragte am 6. Mai 1921 die Umwandlung der Vertretung Bremens in eine Gesandtschaft. In ihrer Sitzung vom 27. Mai 1921 lehnte die bremische Bürgerschaft dieses Ersuchen jedoch mit den Stimmen der drei Linksparteien gegen die Stimmen der zu schwach besetzten bürgerlichen Rechten (44 gegen 40) ab, hob diesen Beschluss aber, nachdem ein erster Antrag des Abgeordneten Dietz (DVP) auf Revision der Beschlüsse am 6. November zurückgestellt worden war, in einer erneuten Sitzung vom 16. Dezember mit den bürgerlichen Stimmen gegen die gesamte Linke wieder auf. Der Senat teilte so dem Präsidenten des Preußischen Staatsministeriums Dr. Friedrich am 27. Dezember die Ernennung Dr. Friedrich Nebelthaus zum a.o. Gesandten und bevollmächtigten Minister bei der preußischen Staatsregierung mit und bat um die Beglaubigung desselben, die am 7. Januar 1922 in Berlin durch den preußischen Staatssekretär Göhre in Vertretung des Ministerpräsidenten Braun erfolgte.
b. Die Aufhebung der Bremischen Gesandtschaft in Berlin und ihre Umwandlung in eine Bremische Vertretung beim Reich.
Preußen, das, wie bereits geschildert, als Gegner des deutschen Föderalismus die Neuetablierung des innerdeutschen Gesandtschaftswesens nach dem 1. Weltkrieg nur ungern gesehen hatte, war trotzdem zur Beibehaltung zweier Gesandtschaften für Süddeutschland in München und für Norddeutschland in Dresden bereit gewesen. Am 22. Juni 1931 teilte jedoch der preußische Ministerpräsident den deutschen Ländern mit, am 31. Mai d. J. sei mit München die letzte noch bestehende preußische Gesandtschaft aufgelöst worden. Für Preußen sei damit überhaupt der Gedanke der innerdeutschen Gesandtschaften als grundsätzlich aufgegeben zu betrachten. Da mit dieser Maßnahme in Zukunft auch eine Beglaubigung deutscher Gesandter bei Preußen nicht mehr zu vereinbaren war, bat man die deutschen Länderregierungen, die Gesandtschaften ihres diplomatischen Charakters bis spätestens zum 31. März 1932 entkleiden zu wollen.
Bremen trat wegen dieser Entscheidung mit den deutschen Ländern in Verhandlungen ein, da man Preußen mit einer gesamtdeutschen Antwort gegenübertreten wollte. Grundsätzlich war der Bremer Senat, wie die anderen Länder, der Ansicht, dass nach der neuen Lage eine Gesandtschaft im staatsrechtlichen Sinne künftig nicht mehr aufrecht zu erhalten war und die Interessenvertretung Bremens allein über den Reichsratsvertreter beim Reich gesucht werden musste. Die öffentliche Meinung ging jedoch im Weltwirtschaftskrisenjahr 1931 über diese rein staatsrechtliche Fragestellung hinaus und forderte Bürgerschaft und Senat auf, zu überprüfen, wie weit in Zukunft die angespannte bremische Finanzlage mit den Kosten einer ohnehin umstrittenen bremischen Vertretung in Berlin zu vereinbaren sei. Mit der Auflösung der Ländergesandtschaften in Berlin und der damit verbundenen Aufhebung der Exterritorialität fielen nämlich auch die steuerrechtlichen Vorteile der Ländervertretungen gegenüber Preußen, was eine nicht unerhebliche finanzielle Neubelastung der Länderhaushalte zur Folge haben musste.
Die Vorlage des bremischen Finanzhaushaltes für das Jahr 1932 führte so im zweiten Halbjahr 1931 in der Bürgerschaft zu heftigen Auseinandersetzungen der Parteien um die Existenz der bremischen Vertretung in Berlin. Anträge der Deutschnationalen Volkspartei, vor allem getragen durch den späteren Senator Erich Vagts, konnten aber stets mit knapper Mehrheit abgelehnt werden. Bremen folgte den übrigen deutschen Ländern. Nachdem Hamburg bereits im Oktober 1931 der preußischen Regierung die Auflösung seiner Gesandtschaft in Berlin mitgeteilt hatte, kündigte der Bremer Senat am 2. November 1931 dem preußischen Ministerpräsidenten an, seiner Anregung zur Aufhebung der deutschen Gesandtschaften bei Preußen mit Schluss des Rechnungsjahres 1931, d.h. zum 31. März 1932, Folge leisten zu wollen. Nach hessischem Vorbild wurde die Gesandtschaft in "Bremische Vertretung beim Reich" umbenannt. An der Aufgabenstellung des bremischen Vertreters Dr. Friedrich Nebelthau änderte sich jedoch nichts.
Einschneidende personelle Veränderungen in der bremischen Vertretung hatte die nationalsozialistische Machtergreifung vom 6. März 1933 in Bremen zur Folge. Am 11. März hatte Bürgermeister Dr. Richard Markert unter Berufung auf den § 2 der Verordnung vom 28. Februar 1933 sämtliche Amtsgeschäfte für Reichs- und auswärtige Angelegenheiten, Verfassungs- und Rechtspflege und innere Verwaltung, soweit sie zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung notwendig waren, übernommen. Zur Kontrolle der bremischen Verwaltung, der Senatoren und der wichtigsten Dienststellen setzte er eine Reihe von Spezialkommissaren ein. Am 15. März ernannte Dr. Markert so völlig rechts- und sinnwidrig den Korvettenkapitän Dr. Rudolf Firle zum Sonderkommissar für die Bremische Vertretung beim Reich (Anlage Bild Nr. 3). Am folgenden Tag übernahm dieser die Geschäfte des beurlaubten Dr. Friedrich Nebelthau, der in der letzten Sitzung des alten Bremer Senats vom 17. März 1933 seine Versetzung in den Ruhestand beantragte, die ihm zum 31. März gewährt wurde. Dr. Firles Ernennung zum "Bevollmächtigten Minister der Freien Hansestadt Bremen beim Reich" wurde zum 1. Juli 1933 vorgesehen, doch schied Firle am 30. Mai 1933 aus dem Staatsdienst aus, mit der Absicht, in den Dienst des Norddeutschen Lloyd zu treten. Zum Nachfolger wurde am 16. Juni 1933 der Präsidialrat Hans Burandt als "Stimmführender Bevollmächtigter zum Reichsrat und bremischer Vertreter beim Reich" ernannt (Anlage Nr. 6), doch dauerte seine Amtszeit nur eineinhalb Jahre. Am 31. Dezember 1934 schied er wegen parteiinterner Spannungen von Berlin.
Erich Vagts, Präsident der Gemeindeaufsichtsbehörde, Landherr und Deutschnationaler, übernahm als Senator am 1. Januar 1935 die Geschäfte der Bremischen Vertretung, die er bis zum Ende derselben im Jahre 1937 führen sollte (Anlage Nr. 7).
c. Das Ende der Bremischen Vertretung in Berlin.
Mit der Auflösung des deutschen Reichsrats am 14. Februar 1934 fielen auch endgültig die Vertretungen der deutschen Länder beim Reich. Reichsinnenminister Frick teilte aber den Länderregierungen mit, dass die Länder auch weiterhin - jedoch in einfacherem Rahmen - Beamte in Berlin belassen könnten, um durch sie insbesondere die wirtschaftlichen Interessen ihrer Gebietskörperschaften besser wahren zu können. Deutlich kommt hier der provisorische Status der Bremischen Vertretung vom Jahre 1934 an zum Ausdruck, deren Bestand in der Folge besonders von der Vertretung Oldenburgs beim Reich immer wieder in Frage gestellt wurde, indem diese auf eine - dem Gau Weser-Ems entsprechende - Vereinigung der Vertretungen Oldenburgs und Bremens drängte. Bremen wahrte auch hier zunächst seine Eigenständigkeit mit Erfolg, umso mehr, als Reichsinnenminister Frick an einer Änderung im norddeutschen Raum bis zur allgemeinen deutschen Reichs- und Kommunalverwaltungsreform nicht gelegen war.
Dem Gedanken der Verwaltungsvereinfachung und Kostenersparnis konnte sich Bremen jedoch auf die Dauer nicht entziehen. Nachdem zugesichert worden war, dass das Land auch künftig in einer gemeinschaftlich bremisch-oldenburgischen Vertretung seine Interessen selbständig durch delegierte Vertreter des Senats wahren könne, stimmte man der Auflösung der Bremischen Vertretung und ihrer Zusammenlegung mit der Oldenburgs zu.
Die Etablierung der "Vertretung Oldenburgs und Bremens in Berlin" unter dem oldenburgischen Ministerialdirektor Meyer-Rodenberg erfolgte am 10. Oktober 1937. Sie bedeutete zugleich das Ende einer eigenständigen Vertretung Bremens in Berlin.
d. Aufgaben und Tätigkeit der Bremischen Gesandtschaft in Berlin.
"Bevollmächtigter Minister der freien Hansestadt Bremen und Stellvertreter des bremischen Vertreters im Reichsrat"; diese Bezeichnung, unter der am 1. Januar 1920 eine selbständige Vertretung Bremens in Berlin geschaffen worden war, lässt deutlich die Doppelfunktion der neuen Institution erkennen: Reichsratsvertretung Bremens und diplomatische Wahrnehmung bremischer Lebens- und Wirtschaftsinteressen im Kontakt mit den Vertretern der deutschen Länder und des Auslands. Schon die Senatsvorlage vom 13. Dezember 1919 zur Schaffung einer selbständigen Bremischen Vertretung hatte die zukünftige Arbeit derselben in der genannten Art umrissen und bis zur Aufhebung des deutschen Reichsrats im Februar 1934 änderte sie ihren Charakter nur wenig.
Das eigentliche Arbeitsfeld des bremischen Vertreters war bis zum Jahre 1934 der Reichsrat, d.h. die Wahrnehmung der Reichsratsvoll- und -ausschusssitzungen, besonders des Hauptausschusses und des Auswärtigen Ausschusses. Teilzunehmen hatte er außerdem an zahlreichen Sitzungen, die der Vorbereitung von Gesetzen usw. dienten, zu denen entweder die Ländervertreter eingeladen wurden, oder die auf Anweisung des Senats zu besuchen waren. Wichtiger war mitunter die Fühlungnahme mit den Reichsministerien zur Unterrichtung über den Gang der Politik der Reichsregierung; desgleichen mit den preußischen Ministerien und den Vertretern der anderen Länder hinsichtlich deren Stellungnahme zu Reichsratsvorlagen u.ä.m. Viel Freiheit freilich blieb dem bremischen Vertreter hier nicht; lag keine besondere Weisung des Senats oder der Senatskommission für Reichs- und auswärtige Angelegenheiten vor, so war er gehalten, wie Preußen zu stimmen.
Ein vielfältigeres und weiteres Feld bot die eigentliche diplomatische Tätigkeit des bremischen Vertreters, d.h. insbesondere die Wahrnehmung der bremischen Wirtschaftsbelange gegenüber dem In- und Ausland, die mündliche oder schriftliche Anhörung bremischer Wirtschaftskreise und ihre Vermittlung an die entscheidenden Stellen der Reichsregierung oder des ausländischen diplomatischen Korps.
Während der Amtszeit Dr. Friedrich Nebelthaus vom 1. Januar 1920 bis zum 31. März 1933 dominierte die Tätigkeit des bremischen Vertreters im Reichsrat. Die restaurative Politik des bremischen Vertreters, der in Berlin wegen seiner Bescheidenheit und Tüchtigkeit allgemein geschätzt wurde, entsprach in den Nachkriegsjahren nicht mehr den Erfordernissen der durch politische Wirren und Wirtschaftskrisen unruhigen Zeit. Gerade im Konkurrenzkampf Bremens mit dem Hamburger Hafen und seiner Wirtschaft fehlte es der bremischen Vertretung bis 1933 an Tatkraft und Härte, nicht selten wurden Vorwürfe in der bremischen Wirtschaft laut, die ein intensiveres Eintreten ihrer Vertretung in Berlin forderten. Ein Spiegelbild dieses Missverhältnisses bieten die Akten der Vertretung dieses Zeitraumes - nur allzu wenig berichten sie vom wirtschaftlichen Auf und Ab der Stadt.
Eine Wende brachte das Jahr 1933 mit dem Ausscheiden Dr. Friedrich Nebelthaus in Berlin. Bereits sein Nachfolger Dr. Rudolf Firle weist deutlich auf die schwierige Stellung Bremens in Berlin hin und zeigt die Vernachlässigung der bremischen Wirtschaftsinteressen in den vergangenen Jahren auf. Müssen hier auch parteipolitische Abstriche gemacht werden, so bleibt doch die Tatsache bestehen, dass Bremens Wirtschaft in den zwanziger Jahren nur allzu oft von Hamburg überspielt worden war, nicht zuletzt durch die aktive Politik der Hamburger Vertretung in Berlin. Auf Forderung des Regierenden Bürgermeisters Dr. Richard Markert und im Einverständnis mit der Handelskammer wurde die bremische Wirtschaft nun aufgefordert, ihre Wünsche und Anregungen allein durch die Vermittlung der Bremischen Vertretung beim Reich an die Reichsministerien heranzubringen. Dies war in der Vergangenheit oft nicht geschehen; an Stelle der Bremischen Vertretung waren persönliche Kanäle und Kontakte bemüht worden, denen nur allzu oft im entscheidenden Moment die offizielle Unterstützung des bremischen Staates fehlte.
Mit dem 14. Februar 1934 wurde der deutsche Reichsrat aufgelöst, womit für den bremischen Vertreter beim Reich auch die Arbeit im Reichsrat entfiel. Im Wesentlichen auf die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Interessen Bremens konzentriert, endete die Tätigkeit des letzten bremischen Vertreters, Senator Erich Vagts, am 10. Oktober 1937 mit der Auflösung der Bremischen Vertretung beim Reich und der Schaffung der "Vertretung Oldenburgs und Bremens in Berlin".
e. Registratur und Aktenführung der Bremischen Gesandtschaft in Berlin.
Registratur und Aktenführung der Bremischen Gesandtschaft in Berlin schließen sich eng an die Verhältnisse der 1920 aufgelösten Hanseatischen Gesandtschaft in Berlin an. Gustav Klünner, späterer Regierungsrat, der bereits als Sekretär der Hanseatischen Gesandtschaft angehört hatte, erstellte eine klassische systematische Sachaktenregistratur aus Betreffakten bzw. Betreffserien (Anlagen Nr. 8, 9 und 10); zur Bildung von Einzelfallakten gelangte er in der Regel nicht, doch sind die Betreffakten vielfach durch Einzelfallaktenansätze (Anlage Nr. 11) gegliedert, ohne dass es zu einer äußeren Spaltung kam. Unterschiedlich war die Tiefe seiner Systematik gestaltet. Gliederte er mitunter auch bis zu 5 Schichten, so leidet seine Systematik doch daran, dass sie in vielen Fällen eine zu geringe Tiefe aufweist. Die Folge waren vielfältige "Allgemeines"- und "Verschiedenes"-Positionen, die den spezifischen Akteninhalt nur ungenügend angeben. Die Positionen innerhalb der Aktenschichten wurden in der Regel nicht logisch voneinander abgegrenzt. Die nach bremischem Vorbild lose geführten Akten (Anlagen 12, 13 und 14) wurden in der Berliner Registratur nach Präsentatum und Tagebuchnummer abgelegt, und zwar von unten nach oben, sodass das jüngste Datum des Eingangs oben erscheint. Bei Vorgängen, bei denen die Tätigkeit des bremischen Vertreters als Reichsratsvertreter überwog, wurden mitunter zwei chronologische Serien innerhalb des Betreffaktenbandes gebildet, deren eine die gedruckten Reichsgesetze, Reichsverordnungen etc. umfasste und dem Band zu Anfang beigefügt wurde.
Vom Anfang bis zum Ende ihres Bestehens führte die Registratur der Bremischen Vertretung ein ebenfalls als klassisch zu bezeichnendes Brieftagebuch, was für die Jahrzehnte der Sachaktenkrise und der Büroreform eine Besonderheit darstellt. Neben diesem allgemeinen Brieftagebuch wurde vom 21. Juni 1934 bis zum 8. März 1935 ein Geheim-Tagebuch der Vertretung geführt (jetzt: 3-C.4.b.1.Nr. 139), das offensichtlich Eingänge aufnahm, die nicht in die normale Postvorlage gelangen sollten, umso mehr, als sie hochpolitische und parteiinterne Vorgänge umfassten.
Die Akten der Bremischen Gesandtschaft befinden sich heute zum allergrößten Teil im Staatsarchiv Bremen, dem sie am 29. September 1937 durch den letzten bremischen Vertreter in Berlin, Senator Erich Vagts, zugeschickt wurden. Geringe Teile, besonders Akten, die die Reichsreform und die Kommunalverwaltungsreform betrafen, wurden am 27. September 1937 der Senatsregistratur zur weiteren Verwendung übersandt. Andere kamen nach der Auflösung der Bremischen Vertretung am 10. Oktober 1937 an die gemeinsame Vertretung Oldenburgs und Bremens in Berlin, wo sie während des Krieges durch Brand vernichtet wurden. Unbekannt ist der Verbleib der im Geheim-Tagebuch verzeichneten Akten; obwohl in die allgemeine Systematik der Berliner Registratur eingeordnet, befinden sie sich heute nicht unter den im Staatsarchiv Bremen verwahrten Aktenbeständen.
[Anm.:] Einzelne Geheimakten offenbar nach 1945 in die Senatsregistratur eingeordnet: 2.B.3-N.7.Nr.415 = 4,49-1551
2. Bearbeitungsbericht der Neuverzeichnung
Mit der Neuordnung des Aktenbestandes der Bremischen Gesandtschaft Berlin wurde im Juni 1967 begonnen. Bereits vorher waren die Akten im Staatsarchiv Bremen neu konvolutiert worden, zugleich waren in dem vorhandenen Aktenplan der Altregistratur die Laufzeiten der Akten provisorisch ergänzt worden.
Die nur ungenügend erschlossenen Betreffakten der Registratur machten eine Neuverzeichnung notwendig, umso mehr, als die durch Schlagworte gekennzeichneten Betreffaktenbände ihren spezifisch bremischen Inhalt in den wenigsten Fällen erkennen ließen. Eine umfassende Erschließung durch "Enthält"-, "Darin"- und "Intus"-Vermerke musste hier Abhilfe schaffen. Der "Intus"-Vermerk erschließt Dokumentationswerte, die für die historische Forschung oder eine andere Fachwissenschaft von Bedeutung sein können, im Aktentitel jedoch nicht genannt sind, da sie dem Entstehungszweck nach hier strenggenommen Fremdkörper darstellen. Der Vollinhalt eines Betreffaktenbandes wurde durch "Enthält"-Vermerke wiedergegeben; eine Einschränkung vollzieht "Enthält nur", die Herausstellung eines besonderen Inhalts "Enthält besonders". "Darin" (= Hierin) soll den Benutzer auf eine Auswahl des Akteninhaltes hinweisen. Diese, für die archivische Titelaufnahme von Betreffakten recht weitgehende Maßnahme musste ergriffen werden, da die besonderen und abweichenden Dokumentationswerte in einem Generalrepertorium bisher nicht nachgewiesen werden können.
In die Systematik des vorgefundenen Aktenplans wurde in der Regel nicht eingegriffen, nicht zuletzt aus arbeitsökonomischen Gründen. Eingriffe innerhalb der Aktenstufe, sowie Vertiefungen der Systematik beseitigten grobe Mängel derselben. Zusammenziehungen von Einzelpositionen verhinderten ein künstliches Aufschwemmen der Systematik. Die Bildung neuer Gruppentitel wurde vorgenommen, um ein besseres logisches Vordringen in die Aktenstufe zu ermöglichen. Zur Erfassung der umfangreichen und oft versteckten Akteninhalte schien neben der Neuverzeichnung die Erstellung eines Index auf der Grundlage der Titelaufnahme als unumgänglich.
Eine archivische Auslese wurde nur in geringem Umfang vorgenommen; neben wenigen unbedeutenden oder nicht zur Entfaltung gelangten Betreffaktenbänden konnten vor allem große Teile der Gruppe XI kassiert werden (vgl. die Kassationsliste).
Kassationsliste:
I.B.5.a. Neugestaltung des diplomatischen und konsularischen Dienstes
I.E.2.d.8. Viermächtepakt
II.F.2.k. Umfrage des Ausschusses zur Heranbildung unserer wirtschaftlichen Kräfte im vorläufigen Reichswirtschaftsrat
II.M.1. Wirtschaftliche Tagesberichte
II.M.2. Fachpressekonferenzen
II.M.3. Pressekammern
II.M.4. Verein Deutscher Zeitungsverleger E.V.
III.A.5.e. Handelskammer Berlin
III.A.5.o. Handelskammern - Verschiedenes
III.A.8.f. Internationales Institut für Bergwirtschaft
III.B.3.a. Viehzählungen
III.B.4.h. Kakao
III.B.4.q. Reichskommissar für die Vieh-, Milch- und Fettwirtschaft
IV.F.2.f. Reichskommissar für das Siedlungswesen
V.C.2.i. Errichtung von Darlehenskassen
VI.B.9.e. Verschiedenes
VI.E.12. Elbregulierung
VI.F.1.b. Beschwerden über Unregelmäßigkeiten im Postverkehr
VI.F.4.p. Fernsehwesen
XI.B.3. Schreibmaschine der Gesandtschaft
XI.B.3.a. Dienstfahrrad
XI.B.4. Fernsprechanschluss der Gesandtschaft
XI.B.6. Beschaffungswesen
XI.C.2. Bankkonto
XI.C.3. Bürokasse
XI.D.1.a.1. Mietvertrag mit Louis Reimann (teilkassiert)
XI.D.1.a.2. Einweisung der Gesandtschaft in das Dienstgebäude Matthäikirchstr. 29 (teilkassiert)
XI.D.1.b.1. Instandsetzungsarbeiten
XI.D.1.b.2. Wohnungsmiete usw.
XI.D.1.c.1. Heizung der Amtsräume
XI.D.1.d. Mietervertretung des Hauses Rauchstr. 8
XI.D.1.e. Hauswart
XI.D.2.a.1. Verschiedene Hausangebote
XI.D.2.a.4. Erlass der Grunderwerbssteuer
XI.D.2.a.5. Erlass der Gebühr für die Eintragung in das Grundbuch
XI.D.2.a.7. Zu verkaufendes Altmaterial
XI.D.2.a.8. Gesuche von Architekten und Handwerkern um Übertragung von Umbauarbeiten
XI.D.2.a.10. Ausstattung der Räume
XI.D.2.a.11. Umzüge
XI.D.2.b.1.-4. Vermietung freier Räume (teilkassiert)
XI.D.2.c.1.-10. Steuern, Abgaben und Versicherungen
XI.D.2.d.1.-2. Verschiedenes
XI.D.2.d.4.-7. Verschiedenes
Das maschinenschriftliche Verzeichnis wurde 2015 in die Datenbank erfasst und 2016 online publiziert.
Schleier Dez. 2016
Enthält
Außenpolitik - Innenpolitik - Wirtschaftspolitik - Sozialpolitik - Finanzpolitik - Verkehrspolitik - Rechtswesen - Landesverteidigung - Kommunalpolitik - Bremische Angelegenheiten - Bremische Gesandtschaft Berlin
Literatur
A. v. Brandt, Das Ende der Hanseatischen Gemeinschaft (HGbll. 1956)
Fr. Nebelthau, Aus meinem Leben, Stuttgart 1939
H. Schwarzwälder, Die Machtergreifung in Bremen 1933, Bremer Veröffentlichungen zur Zeitgeschichte, Heft 1, Bremen 1966
Siehe
Korrespondierende Archivalien
StAB 3-C.4.b.1.
Weitere Angaben (Bestand)
Umfang in lfd. M.
33